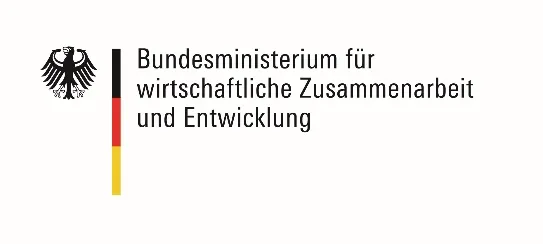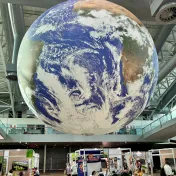Die Klimakrise erreicht 2025 einen neuen Höhepunkt. Auf der Weltklimakonferenz (COP30) diskutieren die Länder darüber, wie sie sich besser an den Klimawandel anpassen, wer dafür zahlt und wie die gemeinsamen Klimaziele erreicht werden können. Die COP30 findet vom 10. bis 21. November in der brasilianischen Stadt Belém statt. Dieser Blog versorgt dich mit allen wichtigen Infos dazu.
Die diesjährige Klimakonferenz findet in einer schwierigen Zeit statt. In vielen Ländern wächst der Einfluss von Rechtspopulismus und Radikalismus. Kriege wie der in der Ukraine dauern an und das Vertrauen in internationale Zusammenarbeit ist schwach. Staaten geben viel Geld für Verteidigung aus und sparen bei der Entwicklungszusammenarbeit. Gleichzeitig werden die Folgen des Klimawandels immer deutlicher sichtbar.
Doch es gibt auch gute Entwicklungen: Der Ausbau erneuerbarer Energien nimmt Fahrt auf, und auf Klimakonferenzen können Länder gemeinsam Lösungen entwickeln. Dass die COP30 in Belém stattfindet, hat dabei eine besondere Bedeutung. Die Stadt liegt mitten im Amazonasgebiet, umgeben von tropischem Regenwald – einem der wichtigsten Ökosysteme der Erde. Das ist ein starkes Symbol für den Schutz von Klima und Natur.
Welche Fragen werden auf der COP30 verhandelt? Hier haben wir die wichtigsten und drängendsten Themen zusammengestellt, mit denen sich die Länder befassen müssen, um Lösungen für die Klimakrise zu entwickeln.
Anpassung: Mit den Folgen des Klimawandels leben
Durch die steigende Erderwärmung erleben wir auf der Welt immer öfter Stürme oder Starkregen, aber auch Dürren und großflächige Waldbrände. Diese extremen Wetterereignisse richten große Verwüstungen an und zerstören Menschenleben und Naturräume. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an diese Folgen des Klimawandels besser anpassen. Die Länder müssen Ideen, Pläne und Werkzeuge entwickeln, um mit diesen extremen Wettern umzugehen. Dafür wurde bereits im Pariser Klimaabkommen von 2015 das „Globale Anpassungsziel“ beschlossen. Um unsere Fortschritte bei der Anpassung messen zu können, brauchen wir gemeinsame Messgrößen, sogenannte Indikatoren.
Diese Indikatoren werden derzeit noch entwickelt, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Auf der COP30 müssen sich die Länder nun darauf einigen, welche Indikatoren in Zukunft herangezogen werden sollen. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Länder des Globalen Südens wollen, dass auch gemessen wird, wie viel Geld und technische Unterstützung ein Land für die Anpassung an den Klimawandel überhaupt hat und wie viele Kapazitäten bereits aufgebaut wurden. Viele Industrieländer, etwa die EU oder die USA, sind dagegen. Schon bei den Vorverhandlungen in Bonn wurde darüber gestritten, dabei konnte sich der Globale Süden bei einigen Punkten durchsetzen. Insgesamt liegen 113 mögliche Indikatoren auf dem Tisch, über die in Belém diskutiert wird.
Nationale Klimaziele: Die Länder müssen deutlich mehr tun
Ein zweites wichtiges Thema sind die nationalen Klimaziele. Sie sind das eigentliche Herzstück des Pariser Klimaabkommens von 2015: In den Klimazielen legt jedes Land selbst fest, was es tun will, um die Erderwärmung zu begrenzen – etwa wie viel Prozent an Treibhausgasen es einsparen will. Diese nationalen Klimaziele sind entscheidend, um die Klimakrise zu bekämpfen.
Bisher sind diese Ziele jedoch nicht stark genug. Die Globale Bestandsaufnahme auf der COP28 hat gezeigt: Selbst wenn wir nur unsere aktuellen Klimaziele zu 100% erreichen würden, könnte die Temperatur auf der Erde um 2,1 bis 2,8°C steigen. Das ist zu viel, denn Pariser Abkommen haben wir vereinbart, dass wir die Erwärmung auf 1,5°C begrenzen wollen.
Alle fünf Jahre müssen die Länder ihre Klimaziele überarbeiten und nachschärfen, 2025 war es wieder so weit. Viele Staaten, darunter auch die EU, haben es versäumt, ihre neuen Ziele rechtzeitig einzureichen. Schon bei der COP29 gab es kaum Fortschritte, obwohl alle auf neue Pläne gewartet hatten. Brasilien hat als Gastgeberland die Länder immer wieder gedrängt, ihre neuen, verbesserten Klimaziele vorzulegen. In Belém müssen sie das endlich tun.
Emissionsminderung: Schnell und fair zur Energiewende
Für die Bekämpfung des Klimawandels ist sehr wichtig, dass wir aufhören, fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Deswegen hat die Weltgemeinschaft im Jahr 2023 auf der Klimakonferenz in Dubai beschlossen, sich von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas abzuwenden. Bis 2030 sollen erneuerbare Energien wie Wind und Sonne dreimal mehr genutzt werden. Außerdem soll Energie soll doppelt so effizient eingesetzt werden, sodass wir insgesamt weniger verbrauchen. Auf der COP29 und den Zwischenverhandlungen wäre es wichtig gewesen, dieses Energiemaßnahmenpaket weiter voranzutreiben. Doch die Länder haben sich nicht geeinigt. Viele Länder sagen, sie brauchen mehr Geld, um auf erneuerbare Energien umzusteigen. Auf der COP30 müssen sie sich einigen und echte Fortschritte bei der Energiewende machen. Sie müssen Lösungen aufzeigen, wie die beschlossenen Ziele erreicht werden.
Vor zwei Jahren auf der COP27 wurde ein neues Arbeitsprogramm ins Leben gerufen: das Mitigation Work Programme. Es soll sicherstellen, dass die Länder ihre aktuellen Klimaziele wirklich bis 2030 erreichen. Dafür soll es den Ländern helfen, die Lücke zu schließen zwischen dem, was sie tun müssen, und dem, was sie bisher getan haben. Das Arbeitsprogramm ist jedoch seit der COP29 nicht mehr arbeitsfähig, da sich die Länder nicht einigen können. Das muss sich auf der COP30 ändern.
Als Gastgeber der kommenden Weltklimakonferenz kann Brasilien bei der Bekämpfung des Klimawandels eine wichtige Rolle spielen. Das Land will einen Fahrplan zu entwickeln, wie weltweit aus Öl, Gas und Kohle ausgestiegen werden kann („Fossil Fuel Phase-out“), auch mithilfe neuer Bündnisse.
Wichtig ist: Klimaschutz muss gerecht sein. Auf der COP28 wurde deswegen ein weiteres Programm gestartet, das „Just Transition“-Arbeitsprogramm. Es soll dafür sorgen, dass beim Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft niemand benachteiligt wird. Bisher gab es wenig Fortschritt. Auf der COP30 muss endlich entschieden werden, wie dieses Programm umgesetzt wird.
Klimafinanzierung: Es braucht mehr Geld für den Klimaschutz
Klimafinanzierung bedeutet: Länder im Globalen Süden bekommen Geld, um auf erneuerbare Energien umzustellen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und mit klimawandelbedingten Verlusten und Schäden besser umgehen zu können. Die Klimafinanzierung muss erhöht werden, weil die Länder des Globalen Südens die Sicherheit brauchen, dass die Weltgemeinschaft sie unterstützt.
Auf der COP29 wurde das neue Klimafinanzierungsziel beschlossen: Bis 2035 sollen „entwickelte Länder“ (also vor allem Industrieländer) jedes Jahr mindestens 300 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz im Globalen Süden bereitstellen. Doch das reicht nicht. Tatsächlich werden etwa 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr gebraucht. Das haben auch die Länder auf der COP29 anerkannt. Die Lücke soll mit öffentlichem (z.B. staatliches Geld) und privatem Geld (z. B. Kredite von Unternehmen) geschlossen werden. Dafür gibt es jetzt einen Fahrplan: die „Baku-to-Belém Roadmap“. Der „Baku to Belém“-Fahrplan wird jedoch nicht von den Ländern verhandelt, sondern von der aserbaidschanischen und der brasilianischen COP-Präsidentschaft erstellt. Deshalb haben sie die Länder, Expert:innen und Finanzminister:innen um ihre Ideen gebeten. Aber bisher ist noch nicht klar, wie der Fahrplan konkret aussehen wird. Viele Länder sind unzufrieden, weil es noch keine klaren Antworten gibt. Auf der COP30 muss nun dieser Fahrplan vorgestellt werden. Und danach ist es wichtig, ihn auch umzusetzen.
Neben der Baku-to-Belém Roadmap ist auf der COP30 auch die Finanzierung für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels wichtig. Denn im neuen Klimafinanzierungsziel gibt es kein eigenes Ziel für Anpassung. Dieses könnte aber in das Globale Anpassungsziel aufgenommen werden. Anpassung ist sehr wichtig, damit Länder und Menschen besser mit den Veränderungen durch den Klimawandel zurechtkommen. Deshalb müssen die Länder mehr Geld bereitstellen, damit sie sich gut anpassen können.
Verluste und Schäden: Wer zahlt?
Der Klimawandel führt weltweit zu großen Verlusten und Schäden. Damit besonders betroffene und verletzliche Menschen und Länder sie bewältigen können, hat die COP27 in Ägypten einen Fonds (Fonds zur Bewältigung von Verlusten und Schäden) eingerichtet – ein echter Meilenstein. Auf der COP28 wurden für diesen Fonds 700 Millionen US-Dollar versprochen. Auf der COP29 im letzten Jahr waren es nur noch 56 Millionen. Das reicht nicht aus, um die Bedürfnisse der am stärksten betroffenen Menschen zu decken. In Belém muss klar werden, dass der Fonds dauerhaft unterstützt und verlässlich gefüllt wird.
Um genau zu wissen, wo (finanzielle) Unterstützung nötig ist, braucht es einen Bericht. Dieser zeigt, wo Geld oder technische Unterstützung fehlt. Solche Berichte gibt es bereits für andere Themen, zum Beispiel für die Anpassung an den Klimawandel und für die Verringerung von schädlichen Treibhausgasen. Jetzt ist es Zeit, dass wir auch einen Bericht für Verluste und Schäden bekommen. Auf der COP30 muss so ein Bericht jetzt beschlossen werden.
Ernährungssysteme: Was und wie wir essen, heizt das Klima weiter an
Was wir essen und wie wir unser Essen herstellen und damit umgehen, heizt den stark Klimawandel an. Etwa ein Drittel aller Treibhausgase weltweit lässt sich darauf zurückführen. Gleichzeitig führt der Klimawandel zu unberechenbarem und extremem Wetter. Das schadet Pflanzen und Böden und zerstört Ernten, sodass weniger Nahrungsmittel für alle da sind. Deshalb müssen wir dringend ändern, wie wir Lebensmittel produzieren, wie und was wir anbauen, ernten und durch die Welt verschicken.
Viele erwarten von Brasilien, dass es sich als Gastgeberland auf der COP30 besonders stark machen wird für die Themen Ernährung und Landwirtschaft. In Brasilien leben viele Menschen von der Landwirtschaft und das Thema spielt eine zentrale Rolle in der Politik des Landes. Zudem findet die Konferenz findet mitten im Amazonasgebiet statt, das einerseits eine wichtige Rolle im Klima- und Umweltschutz spielt und wo andererseits große Flächen für Landwirtschaft und Viehzucht abgeholzt werden.
Zwar wird Ernährung auf der COP30 kein eigener Verhandlungspunkt sein. Aber sie hängt mit vielen anderen Bereichen eng zusammen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass Ernährungssysteme auch in den nationalen Klimaplänen eine Rolle spielen oder Geld in der Baku-to-Belém Roadmap auch für Ernährungssysteme bereitgestellt wird. Und beim Globalen Anpassungsziel ist es wichtig, dass die Indikatoren auch Ernährungssysteme umfassen.
Gefördert durch Engagement Global und Mittel des