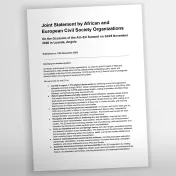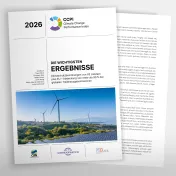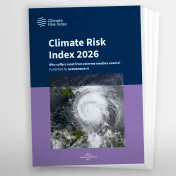Internationale Klimazusammenarbeit
Weltweite Klima- und Energiesicherheit bedarf internationaler Strategien. Das Verhandeln im Rahmen der UNO gehört ebenso hierzu wie Koalitionen von Vorreiter-Staaten. Grundlage hierfür müssen wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben. Unsere Zielsetzung: Die Entwicklungschancen der Ärmsten zu erhalten.